Autogenes Training bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Es gibt sehr überzeugende Beweise, dass Entspannungsübungen mehr sind als nur ein netter Zeitvertreib oder eine Marotte esoterisch angeknackster „Spinner“. Entspannungsübungen haben offenbar einen sehr tiefgreifenden Effekt auf das physiologische Geschehen in unserem Organismus. Das würde bedeuten, dass eine praktizierte Entspannungsübung einen medikamentösen oder medikamentenartigen Effekt auf den Organismus ausübt.
Im Folgenden möchte ich daher der Frage nachgehen, ob sich dies auch für das Autogene Training nachweisen lässt. Wenn ja, welches Ausmaß dieser Einfluss auf die Physis der Anwender hat. Wie es aussieht, gibt es zu einer Reihe von medizinischen Indikationen bereits entsprechende und sogar neuere Untersuchungen für das Autogene Training. In diesem Beitrag möchte ich mich daher auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschränken, die ganz weit oben auf der Liste der Ursachen für Todesfälle stehen.
Im Jahr 1997 wurde eine Arbeit veröffentlicht, die Patienten mit und ohne Autogenem Training beobachtete, die sich einer Bypassoperation hatten unterziehen müssen.
Rakov AL, Mandrykin IuV, Zamotaev IuN.
in: Voen Med Zh. 1997 Feb;318(2):37-41, 79.
Insgesamt nahmen 115 Patienten an der Studie teil, 70 Patienten mit und 45 ohne Autogenes Training. Zudem wurde der psychische Zustand der Patienten untersucht. Alle Patienten zeigten eine mehr oder weniger stark ausgeprägte psychologische Fehladaptation, die sich in hypochondrischen und asthenoneurotischen Reaktionen äußerte.
Ein spezieller Fragebogen (Spielbergers psychometrische Skala) erfasste die emotionalen Spannungen, die zudem von anderen Parametern bestätigt werden konnten. Das waren die Messungen von Peroxid-Oxidation von Lipiden und eine mathematische Analyse des Herzrhythmus.
Leider gibt es keine Angabe zur Dauer der Studie beziehungsweise des Autogenem Trainings während dieser Zeit. Aber die Autoren berichten, dass die AT-Gruppe eine Verbesserung der klinischen Parameter zu verzeichnen hatte. Gleichzeitig gab es auch Verbesserungen in psychologischen Bereich.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Fazit:
Diese Studie gibt erste Hinweise, dass das Autogene Training psychologische und damit verbunden physiologische Probleme positiv beeinflussen kann. Die physiologische Beeinflussung scheint sogar so weit zu reichen, dass elementare Prozesse, wie zum Beispiel die Aktivität freier Radikale, modifiziert werden können.
Meta-Analysen sind nicht der „wahre Jakob“ unter den Studien. Sie sind immer mit einigem Vorbehalt zu „genießen“.
Denn eine selektierende Auswahl an Arbeiten kann und wird in der Regel das Ergebnis liefern, was der Autor sich wünscht. Und es ist nicht leicht, ein solches selektives Vorgehen zu erkennen und auszuschließen.
Eine weitere Meta-Analyse aus dem Jahr 2002 untersuchte die Frage, welche klinische Effektivität das Autogene Training überhaupt hat. Dazu wurde nach bereits existierenden Arbeiten gefahndet. Die Autoren fanden 60 Arbeiten, davon 35 randomisierte klinische Studien, die sie für geeignet erachteten, Aussagen über die klinische Wirksamkeit von Autogenem Training machen zu können.
Es zeigte sich bei der Analyse, dass das Autogene Training bei den klinischen Studien einen mittelmäßigen bis hohen Effekt ausgeübt hatte. Bei unspezifischen Effekten, zum Beispiel den Einfluss auf das Gemüt, kognitive Fähigkeiten, Lebensqualität und so weiter, zeigte das Autogene Training sogar noch bessere Wirksamkeit.
Eine spezielle, zusätzliche Meta-Analyse (der Meta-Analyse) für verschiedene Erkrankungen zeigte bei den Studien, die mit einer Kontrollgruppe gearbeitet hatten, positive Effekte bei der koronaren Herzkrankheit und leichtem bis mittelschwerem Bluthochdruck. Andere Erkrankungen mit positivem Effekt waren Migräne, Spannungskopfschmerzen, Asthma bronchiale, Schmerzen, Raynaud Syndrom, Erregungszustände, Depressionen und funktionelle Schlafstörungen.
Fazit
Um es ganz genau zu nehmen, würde mich alleine eine Meta-Studie nicht von den Vorzügen des Autogenen Trainings überzeugen. Auch die Tatsache, dass eine Unterauswertung gemacht wurde, ist kein „Zusatzargument“ für das Autogene Training. Die Arbeit gibt bestenfalls einen Überblick über die bislang geleistete Arbeit in diesem Bereich und lässt einen Einblick zu, wie das Autogene Training bei Studien abschneidet. Sie ist eine Art „Fingerzeig“, der eine positive Wirkung bei bestimmten Erkrankungen vermuten lässt, aber nicht beweist.
2004 wurde diese Arbeit veröffentlicht:
Kanji N1, White AR, Ernst E.: Complementary Medicine, Peninsula medical School, Universities of Exeter and Plymouth, Exeter, United Kingdom.
Autogenic training reduces anxiety after coronary angioplasty: a randomized clinical trial
in: Am Heart J. 2004 Mar;147(3):E10.
Angioplastie ist ein invasives Verfahren, um verstopfte Arterien (seltener Venen) mit Hilfe eines Katheters wieder zu öffnen. In diesem Fall handelt es sich um die Herzkranzgefäße, die auf diese Weise behandelt wurden. In dieser Studie wurden 59 Patienten in Verum- und Kontrollgruppe aufgeteilt und über 5 Monate beobachtet, ob das Autogene Training in der Lage war, Unruhe- und Angstzustände bei den behandelten Patienten zu verringern.
Das Hauptziel der Arbeit war die Messung und Beurteilung von Angstzuständen nach 2 Monaten nach dem Eingriff. Die qualitativen Informationen dazu wurden durch Interviews mit den Patienten erhoben.
Resultat: Die Angst- und Unruhezustände zeigten nach 2 und 5 Monaten einen signifikanten Unterschied in beiden Gruppen zugunsten des Autogenen Trainings. Diese Befunde wurden zusätzlich unterstützt durch weitere Beobachtungen bezüglich der Lebensqualität, zum Beispiel, die sich ebenfalls in der Verumgruppe als deutlich höher erwies.
Allerdings schränkten die Autoren ein, dass die beobachteten positiven Effekte nicht notwendigerweise dem Autogenen Training zuzuschreiben sein könnten, sondern dass hier möglicherweise unspezifische Effekte dazu beigetragen hätten. Trotzdem schließen sie, dass das Autogene Training eine positive Rolle bei der Reduzierung von Angst- und Unruhezuständen bei Patienten mit koronarer Angioplastie zu haben scheint.
Fazit
Ich denke hier, dass die Autoren tendenziell zu vorsichtig mit ihren Interpretationen sind. Denn wenn nicht das Autogene Training für die positiven Wirkungen verantwortlich ist, sondern unspezifische Effekte, dann erhebt sich die Frage, warum die Unterschiede zur Kontrollgruppe so signifikant ausgefallen sind. Bei unspezifischen Effekten würde man keinen Unterschied zur Plazebogruppe erwarten. Was sich aus dieser Arbeit nicht ableiten lässt, ist die Frage, über welche Mechanismen der beobachtete positive Effekt zustande gekommen ist. Er steht aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einem Zusammenhang mit dem Autogenen Training.
Miu AC1, Heilman RM, Miclea M.: Program of Cognitive Neuroscience, Department of Psychology, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, CJ 400015, Romania. andrei_miu@emcoglab.org
in: Auton Neurosci. 2009 Jan 28;145(1-2):99-103. doi: 10.1016/j.autneu.2008.11.010. Epub 2008 Dec 6.
Diese Arbeit von 2009 untersuchte den Einfluss des Autogenen Trainings auf das parasympathische Nervensystem. Hierzu wurden körperlich gesunde Freiwillige mit ausgeprägten, lang anhaltenden Unruhe- und Angstzuständen ausgesucht. Diese Teilnehmer wurden in der Folge mit Autogenem Training behandelt. Als Parameter für den Einfluss des parasympathischen Nervensystems wurde die Herzfrequenzvariabilität bestimmt.
Je höher diese ausfällt, umso besser steht es mit der Herzgesundheit. Zum Einsatz dafür kamen EKG, Bestimmung der Herzfrequenz und Hoch- und Niedrigfrequenz und deren Ratio. Die Messungen wurden während Stresssituationen und Übungen mit Autogenem Training gemacht. Zusätzlich wurden Atemfrequenz und die Leitfähigkeit der Haut gemessen.
Das wichtigste Ergebnis der Messung war, dass hohe Unruhe- und Angstzustände mit einem reduzierten R-R-Intervall im EKG verbunden waren, was mit einiger Wahrscheinlichkeit mit einer „chronisch erhöhten“ Herzfrequenz in diesen Situationen zusammenhängt. Im Vergleich zur mentalen Stresssituation erhöhte Autogenes Training die Herzfrequenzvariabilität und stützte die parasympathische (vagale) Steuerung des Herzens.
Schlussfolgerung der Autoren: Eine reduzierte Herzfrequenzvariabilität ist ein wichtiger Risikofaktor bei Unruhe- und Angstzuständen für die Ausbildung von kardialen Schäden und Problemen. Diese Schäden treten mit hoher Wahrscheinlichkeit als Langzeitkonsequenz dieser vegetativ-autonomen Dysfunktion auf.
Fazit
Stresszustände, besonders aber Dauerstress, wie er auch oft beim Burn-out-Syndrom zu beobachten ist und hier bei permanenten Unruhe- und Angstzuständen, ist verbunden mit einer signifikanten Abnahme der Herzfrequenzvariabilität. Dies ist mit bedingt durch eine hohe Konzentration an Katecholaminen im Blut, die die Herzfrequenz hochtreiben.
Der Effekt ist vergleichbar mit einem Motor, der permanent auf Hochtouren läuft. Seine Lebensdauer ist nur sehr begrenzt. Für das Herz gilt das Gleiche. Schädigungen sind hier schon vorprogrammiert.
Bedingt dadurch kann der Vagus keinen entscheidenden Einfluss auf die Herzfrequenz ausüben. Im Gegensatz zur Atmung, deren Frequenz wir zeitlich beschränkt willentlich verlangsamen oder erhöhen können, ist dies bei der Herzfrequenz nicht der Fall. Der Vagus verursacht eine Senkung und damit Ökonomisierung der Herzarbeit. Besonders stark ausgeprägt ist er während des Schlafs, der Phase, die auch für die Regeneration des Herzens besonders wichtig ist.
Ist diese Regenerationsphase dauerhaft verkürzt, dann ist das kardiale Risiko erhöht. Autogenes Training scheint hier in der Lage zu sein, den Einfluss des Vagus auf das Herz zu fördern und zu stärken, was die Regenerationsleistung des Herzens erhöhen und somit das kardiale Risiko mindern würde. Das klingt noch etwas hypothetisch, aber nicht unlogisch. Hier bräuchten wir große epidemiologische Untersuchungen, die solche Annahmen unterstützen könnten.
Fazit zum Thema „Autogenes Training bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen“
Autogenes Training scheint ein gutes „Präparat“ gegen Stress zu sein, da es sehr effektiv die damit verbundenen kardiovaskulären Konsequenzen kupiert. Dieser protektive Effekt erfolgt nicht nur über eine äußerliche „Beruhigung“ des Übenden, sondern scheint auch tiefgreifende physiologische Reaktionen auszulösen, wie zum Beispiel die Reduzierung von oxidativem Stress, Verstärkung des parasympathischen Nervensystems beziehungsweise des vagalen Einflusses auf das Herz, Senkung der Herzfrequenz, Erhöhung der Herzfrequenzvariabilität und so weiter.
Damit lässt sich schließen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Autogenes Training ein gutes Mittel zur Prophylaxe und begleitenden Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Dieser Artikel wurde am 29.4.2019 erstellt.
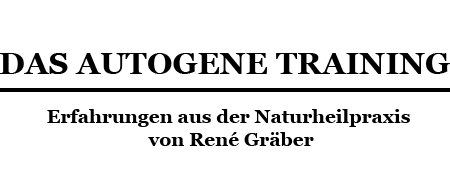



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!